
Key Facts zum Mineralölmarkt in Österreich
Fachverband der Mineralölindustrie
Lesedauer: 9 Minuten
In den Key-Facts zum Mineralölmarkt finden Sie Informationen zum internationalen und österreichischen Kraftstoffmarkt, die in der öffentlichen Berichterstattug manchmal zu kurz kommen oder unerwähnt bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Branche braucht
- Eine Branche auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität
- Mobilität der Zukunft – was werden wir in Zukunft tanken?
- Die Tankstelle der Zukunft als Multi-Service-Hub
- Zukunftsmarkt Petrochemie: Nachhaltig durch Zirkularität
- Versorgungssicherheit in Krisenzeiten
Welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Branche braucht
Technologievielfalt als Gebot der Stunde
Es braucht die Akzeptanz aller verfügbaren Energieträger, da diese auch in Zukunft in den wesentlichen Sektoren Produktion, Verkehr und Raumwärme benötigt werden. Einzelne Energieträger dürfen nicht diskriminiert werden, denn Einschränkungen in der Auswahl der Technik verhindern Innovation, statt die breite Erforschung und Implementierung CO2 -armer bzw. -freier Technologien zu ermöglichen. Bevor über Verbote nachgedacht wird, müssen entsprechende Alternativen verfügbar gemacht werden.
Innovation ist der Schlüssel zur Klimaneutralität
Investitionen in F&E sind die zentrale Stellschraube auf dem Weg in die Zukunft. Die Industrie – der Treiber von Forschung und Entwicklung – und allen voran die Mineralölindustrie braucht dafür ein politisches Bekenntnis und einen technologieneutralen Rechtsrahmen. Aufgrund der signifikanten Investitionsund Betriebskosten ist die Förderung von Projekten zur CO2 - Reduktion auf nationaler und europäischer Ebene wesentlich.
Eine gesicherte Energieversorgung erfordert klare Rahmenbedingungen
Heimische, international tätige Industrieunternehmen benötigen entsprechende Rahmenbedingungen in Österreich, um global wettbewerbsfähig zu sein. Um die Versorgungssicherheit mit Energie und Rohstoffen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen im internationalen Kontext auch in der Phase der Transition zu gewährleisten, muss genügend Zeit und Raum für Übergangstechnologien erhalten bleiben.
Schnellere und effiziente Verfahren für Anlagengenehmigungen
Die Genehmigung neuer Betriebsanlagen dauert in Österreich zu lang. Klimaschutz, Standortsicherung und die Transformation der Industrie brauchen möglichst rasche und effiziente Verfahren. Dabei gilt es, das öffentliche Interesse abzuwägen und konkurrierende Umweltziele aufzulösen.
Eine Branche auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität
Wirtschaft, Klima- und Umweltschutz gehören zusammen, denn eine gesunde Umwelt und der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen sind Voraussetzung für eine langfristig stabile wirtschaftliche Entwicklung.
Für Unternehmen erwachsen aus dem Klimaschutz auch neue Geschäftsfelder und Chancen. Um diese zu nutzen, gilt es, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
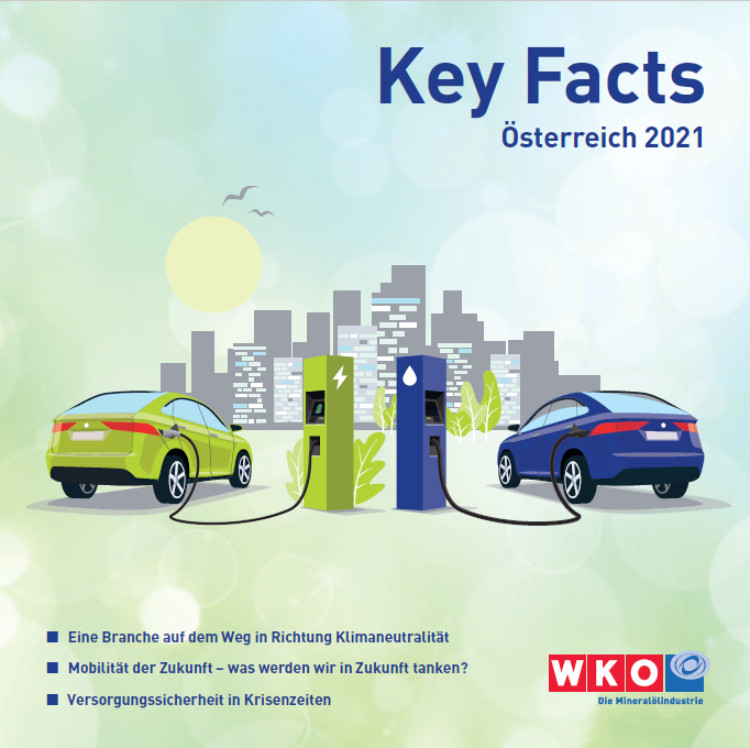
Die Unternehmen der Mineralölindustrie haben sich auf die Reise gemacht, um die Transformation des Energiesystems voranzubringen. So unterschiedlich die Wege, die dabei verfolgt werden, auch sind, so eint sie ein gemeinsames Ziel. Die Branche sieht es als ihre Verantwortung, in eine kohlenstoffärmere Zukunft zu investieren, und wird dabei alle Hebel in Bewegung setzen, um der Klimazielerreichung einen großen Schritt näher zu kommen.
Die Mineralölindustrie ist ein wichtiger Treiber für Lösungen rund um die Frage der Energiezukunft und ein verlässlicher Partner bei der Umsetzung der Energiewende. Sowohl bei der Erdölförderung als auch bei der Erdölverarbeitung werden mit Hilfe zukunftsorientierter Maßnahmen laufend Verbesserungen erzielt, wie durch die Reduzierung von CO2 -Emissionen in den Raffinerien oder bei den flüssigen Kraft- und Brennstoffen.
Der Transformationsprozess, dessen Weichen durch die Unternehmen schon vor Jahren gestellt wurden, ist kein nationales oder europäisches Phänomen, sondern betrifft die Branche weltweit. Der eingeschlagene Weg – von heute noch überwiegend fossilen Erzeugnissen hin zu einem breiten Portfolio an klimaneutralen Prozessen und Energieträgern – ist die gemeinsame Basis.
Das Portfolio an neuen Produkten reicht von E-Mobilität über moderne Biokraftstoffe und grünem Wasserstoff bis hin zu eFuels. Durch die Kommerzialisierung von neuen, saubereren Energieträgern gestaltet die Branche den Transformationsprozess des Energiesystems aktiv mit und leistet einen positiven Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zum Erreichen der Klimaziele.
Bis mögliche Alternativen den Status einer Massentauglichkeit und der Marktdurchdringung erreicht haben, braucht es jedoch noch eine Vielzahl an Innovationen und hohe Investitionen. Die Technologieoffenheit und die Berücksichtigung von Effizienzverbesserungen bewährter Technologien ist daher das Gebot der Stunde bis neue Energieformen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.
Die Herausforderungen der Energiewende in puncto Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Leistbarkeit für die Konsumenten kann kein Energieträger alleine bewältigen.
Mobilität der Zukunft – was werden wir in Zukunft tanken?
Was es braucht, ist eine Mobilitätslösung, die die Klimaziele erfüllt und gleichzeitig den Ansprüchen in Bezug auf Bezahlbarkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit gerecht wird.
Kein leichtes Unterfangen, und doch nicht unmöglich, wenn technologieoffen an die Sache herangegangen wird. Erst wenn alternative Antriebe und Kraftstoffe technisch und von den Kosten her wettbewerbsfähig sind, kann die Mobilitätswende im Massenmarkt gelingen.
Die E-Mobilität ist dafür ein zentraler Baustein. Bei Betrachtung des Wachstums und der Anforderungen des Flug-, Schiffs- oder auch LKW-Verkehrs wird aber auch klar, dass E-Mobilität allein dafür nicht ausreichen wird. Flüssige Kraftstoffe werden auch weiterhin benötigt werden – dank ihrer spezifischen Eigenschaften haben diese insbesondere im Verkehrssektor eine große Bedeutung. Sie können über größere Zeiträume verlustfrei gespeichert und über lange Strecken transportiert werden.
Auch der Einsatzbereich von Wasserstoff wird sich in Zukunft gewaltig vergrößern. Seine Energie kann auch mobil mit einem Brennstoffzellensystem genutzt werden. Dieses ist doppelt so effizient wie ein Verbrennungsmotor, das heißt, man braucht nur die halbe Energie für die gleiche Leistung. Ebenso kann Bio-LNG aufgrund seiner hohen Energiedichte vielfältig eingesetzt werden und einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten, vor allem im Straßengüterund Schiffsverkehr.
Die Entwicklung innovativer Technologien und hocheffizienter Energieträger verleiht der Wirtschaft Flexibilität und die Möglichkeit, für jeden Sektor und jede Anwendung die optimale Lösung zur Energieversorgung zu finden.

Verbrennungsmotor und Klimaschutz sind keine unvereinbaren Gegensätze. Flüssige Energieträger könnten mittlerweile – bei entsprechenden Investitionen und der dafür notwendigen Planungssicherheit – klimaneutral hergestellt werden. Dafür gibt es unterschiedliche technologische Verfahren, die in allen Verkehrssektoren über den gesamten Lebenszyklus hinweg eine emissionsarme Mobilität ermöglichen: Biokraftstoffe, Wasserstoff sowie eFuels, also strombasierte flüssige Kraftstoffe (Power-to-Liquids inkl. Verfahren zur Kohlenstoffabscheidung und -nutzung).
Ein nachhaltiger Mobilitätsmix der Zukunft ist ohne eFuels und Biokraftstoffe nur schwer vorstellbar. eFuels werden ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugt. Zudem stammt das in der Herstellung verwendete CO2 aus der Umgebungsluft. Damit wird das Treibhausgas zum Rohstoff. eFuels können fossile Kraftstoffe schrittweise ergänzen und langfristig ersetzen. Sie wirken unmittelbar im Bestand und somit deutlich schneller als es bei einer Erneuerung der Infrastruktur und ganzer Fahrzeugenfl otten möglich wäre.
Eine technologieoffene Herangehensweise hat den Vorteil, dass sich die Forschung und Entwicklung weiterhin auf die beste Lösung und größte Innovation für eine klimaneutrale Mobilität konzentrieren kann. Politisch verordnete Einschränkungen etwa in der Antriebstechnik würden wesentliche Innovationspotentiale von vornherein ungenützt lassen.
Die Tankstelle der Zukunft als Multi-Service-Hub
Das Tankstellengeschäft unterliegt einem Wandel – Digitalisierung, E-Mobilität und autonomes Fahren sind nur einige Stichworte in diesem Zusammenhang. Wie sieht also die Zukunft für die Tankstellen aus?
Experten sind sich einig, dass sich die Tankstelle der Zukunft zu einem Multi-Service-Hub entwickeln wird. Das Hauptgeschäft wird dann nicht mehr das Tanken sein, sondern eine der zahlreich angebotenen Dienstleistungen.
Schon heute geht der Trend in diese Richtung, denn jeder zweite Kunde kommt inzwischen nicht zum Tanken, sondern um eines der weiteren Angebote wahrzunehmen. Moderne Tankstellen bieten neben Kraftstoffen und Autoservices vielfach auch Lebensmittel zu Supermarktpreisen, Trafik-, Postund Paketservices, Bankdienstleistungen und vieles mehr. Die Kooperationen sind je nach Standort und Unternehmen unterschiedlich, und regelmäßig kommen neue dazu.
Auch Trendforscher Sandro Megerle ist davon überzeugt, dass neue Servicekonzepte den Tankstellenmarkt der Zukunft prägen werden. Er sieht diese nicht nur als Multi-Service-Hub, sondern geht mit der Vision des Mobility-Hotspots noch einen Schritt weiter: Die Tankstelle könnte ein Treffpunkt werden sowohl für Ridesharing-Flotten, die dort auftanken können, als auch für einen Wechsel der Transportart, zum Beispiel für den Umstieg auf einen E-Tretroller oder ein E-Bike.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geht in einer Studie davon aus, dass im Jahr 2040 ein Viertel des Autobestandes autonome Fahrzeuge sein werden. Ein Teil davon werde dann auf „Ghost Trips“ unterwegs sein und an Tankstellen selbstständig alltägliche Dinge für die Kunden erledigen.
Zukunftsmarkt Petrochemie: Nachhaltig durch Zirkularität
Die Industrie hat als wichtigster Wachstumstreiber bei der Ölnachfrage dem Verkehrssektor den Rang abgelaufen
Das bestätigt auch eine Studie der Internationalen Energieagentur (IEA). Das größte prognostizierte Wachstumspotential beim Erdöl liegt in seiner Verwendung als Rohstoff, insbesondere für die petrochemische Industrie. Der Trend geht dabei immer stärker in Richtung hochwertige Kunststoffe oder Polymere, die mit ihren Materialeigenschaften und der Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten im Alltag für mehr Hygiene, Sicherheit und Komfort sorgen.
Kunststoffe sind echte Verwandlungskünstler
Sie sind in der Verpackungs-, Energie- und Automobilindustrie wie auch in der Medizintechnik unverzichtbar. Eine Pandemie ohne die Schutzmöglichkeiten mit Mund-Nasen-Schutz und Schutzbekleidung aus hochwertigen Kunststoffen wäre im Verlauf ungleich dramatischer als mit den Möglichkeiten, die nur Kunststoffe bieten.
Eine Energiewende ohne Kunststoff funktioniert nicht – ob Hochleistungsstromkabel, Windräder, Solarpanels oder E-Autos: Überall stecken Kunststoffe drin. Innovative Kunststoffe gelten als Materialien des 21. Jahrhunderts, die das Leben nicht nur praktischer machen, sondern auch nachhaltiger gestalten, ganz im Sinne der Ressourcenschonung und des Klimaschutzes. Denn werden Kunststoffe wie beim chemischen ReOil®-Verfahren der OMV oder wie bei der mechanischen Wiederverwertung durch die OMV-Tochter Borealis recycelt, unterstützt das die klimaschonende Kreislaufwirtschaft, die den Verbrauch von Primärrohstoffen verringert und somit zur Senkung von CO2 -Emissionen beiträgt.
Auch das Energieunternehmen Eni verfolgt durch sein Tochterunternehmen Versalis eine Strategie der Kreislaufwirtschaft. An erster Stelle steht die Diversifikation im Rohstoffeinsatz, weiters das Öko-Design zur Steigerung der Ressourceneffizienz und schließlich das Recycling von Polymeren durch den Einsatz innovativer Technologien.
Versorgungssicherheit in Krisenzeiten
Neben einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Klimaschutzmaßnahmen und leistbarer Energie ist die Versorgungssicherheit zentraler Aspekt der Energieversorgung.
Durch die Haltung von Pflichtnotstandsreserven an mehr als 40 Standorten kann die Republik Österreich bei Versorgungsengpässen rasch und effizient auf Krisenvorräte zurückgreifen. Mit den von Seiten der ELG (Erdöl-Lagergesellschaft) als "Zentrale Bevorratungsstelle" und deren Vertragspartnern gehaltenen Mengen von rund 3 Mio. Tonnen ist eine Krisenversorgung jederzeit sichergestellt. Grundlage ist das Erdölbevorratungsgesetz 2012, demnach eine Verpflichtung zur Haltung von Notstandsreserven für Erdöl und Mineralölprodukte besteht. Deren Umfang beträgt mindestens 25 Prozent bzw. 90 Tage der Nettoimporte des vorangegangenen Jahres.
Der Mineralölverbrauch zeigt langfristig eine sinkende Tendenz, der Anteil am Bruttoinlandsverbrauch (derzeit 37,1 Prozent) ist aber immer noch der höchste aller Energieträger in Österreich. Die entsprechende Sicherstellung der Versorgung und eine adäquate Krisenvorsorge sind daher von wesentlicher Bedeutung.
Die Mineralölindustrie hat in der Covid-19-Krise gezeigt, wie verlässlich und wie wichtig sie für die Versorgungssicherheit ist. Das betrifft öffentliche Einrichtungen und die Industrie genauso wie den Endkonsumenten und Verbraucher. Aufgrund der verstärkten Vernetzung der globalen Wirtschaft und der Optimierungen der Supply Chains führen derartige Situationen schnell zu massiven lokalen Auswirkungen, Einschränkungen und Engpässen. Derzeit stehen die entsprechenden Kapazitäten, die regionale Verfügbarkeit sowie die logistischen Einrichtungen zur Verfügung. Jedoch werden sich diese Kapazitäten und Verfügbarkeiten mit sinkendem Verbrauch reduzieren. Auch die gesamtgelagerten Mineralölmengen für die 90-tägige Bevorratung werden aufgrund des geringeren Verbrauchs sinken.
Dabei sinkt jedoch nicht der Gesamtenergieverbrauch in Österreich, sondern es kommt zu einer Verlagerung von Mineralölprodukten auf andere Energieträger und hier vorwiegend auf elektrische Energie. Diese Energieträger tragen zurzeit nur einen geringen Teil für die Energieautarkie Österreichs bei. Es genügt daher nicht, durch Gesetze und Verordnungen den Einsatz von Mineralölprodukten zu verbieten – zuerst sind entsprechende gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, welche den Einsatz von alternativen Technologien überhaupt möglich machen und die benötigte Energieversorgung auch in Krisenzeiten sicherstellen. Unabhängig vom Energieträger wird die Bevorratung von Energie in Zukunft für die Volkswirtschaft von essentieller Bedeutung sein.
Die Sicherstellung der Energieversorgung ist unter dem Titel "Blackout" oder "Strommangellage" ein laufendes Thema. Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kommunikationseinrichtungen oder auch der Schienenbetrieb haben zu diesem Zweck ein auf Mineralölprodukten basierendes Backup-System lokal installiert, um einen Notbetrieb sicherzustellen. Die dafür vorgesehenen Lagervolumina an Mineralöl reichen, abhängig von Region und Anlagenbedeutung, für 12 bis 72 Stunden Notbetrieb. Selbstverständlich wird eine längerfristige Versorgung dieser lebensnotwendigen Einrichtungen durch Bevorratung, wie die zentrale Haltung von Reserven, auch in Zukunft sichergestellt.