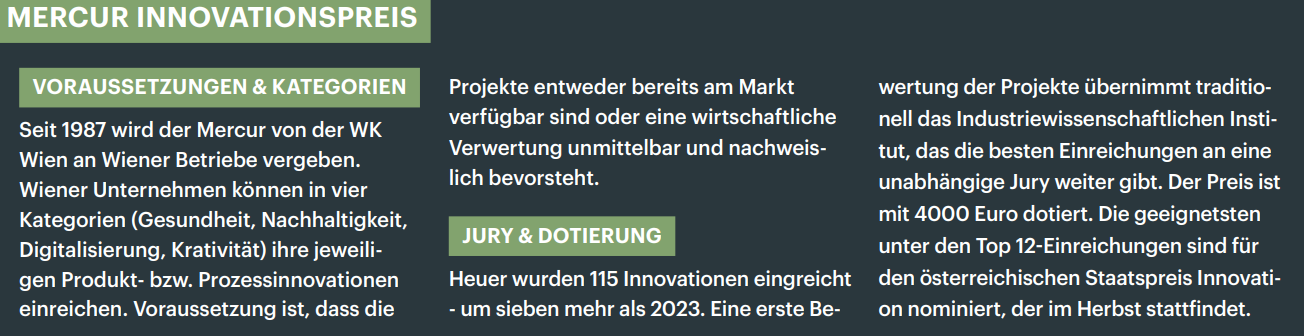Wo Innovationen kräftig sprießen
Neue Entwicklungen und Ideen sind ein wichtiger Wachstumstreiber für die Wirtschaft. Der Mercur Award hebt daher alljährlich Wiens innovativste Betriebe hervor. Wir haben mit den diesjährigen Preisträgern gesprochen.
Lesedauer: 3 Minuten
Im Bild: Für ihre Designstücke aus alten Lattenrosten, die von Mitarbeitern des zweiten Arbeitsmarktes gefertigt werden, bekam die studiolo OG den ersten Platz des Mercur Award in der Kategorie Kreativität
Über einen Mangel an Innovationen kann sich die heimische Wirtschaft zum Glück nicht beklagen. Das zeigen die vielen Einreichungen für den Mercur Innovationspreis, der alljährlich von der WK Wien verliehen wird. „Die diesjährigen Mercur Preisträger beweisen einmal mehr, wie Wiener Unternehmen mit Kreativität und Engagement zukunftsweisende Lösungen schaffen. Ihre Innovationen in den vier Kategorien Kreativität, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzen Jahr für Jahr wieder neue Maßstäbe und zeigen, dass Innovation eine große Stärke der Wiener Wirtschaft ist”, freut sich Walter Ruck, Präsident der WK Wien, über die Innovationskraft der Betriebe in der Bundeshauptstadt. Maßstäbe für die Zukunft setzen
Ihre Innovationen in den vier Kategorien Kreativität, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzen Jahr für Jahr wieder neue Maßstäbe und zeigen, dass Innovation eine große Stärke der Wiener Wirtschaft ist
Walter Ruck,
Präsident der Wirtschaftskammer Wien
Ein gutes Beispiel für Kreativität und Engagement wie auch was damit bewirkt werden kann, ist „snorre: Vom Sperrmüll zum Designobjekt”, das Projekt der studiolo OG. Die beiden Gründer Maximilian Klammer und Thomas Maurer erhielten dafür den ersten Platz in der Kategorie Kreativität des Mercur Innovationspreises. Ein Architekt und ein Marketingexperte taten sich hier zusammen, um aus ausrangierten Lattenrosten aus der Wiener Abfallwirtschaft (MA48) neue, hochwertige Möbelstücke zu machen. Die Herstellung der Designerstücke erfolgt in sozioökonomischen Betrieben der Volkshilfe und der Caritas, wo Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen eine Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt ermöglicht wird. Die beiden Gründer wollen mit dem Projekt alternative Produktionsweisen aufzeigen und neue Maßstäbe in puncto Umweltbewusstsein und sozialer Verantwortung in der Designindustrie setzen. Zielgruppe von „snorre” sind dementsprechend design- und umweltbewusste Kunden, die Wert auf Einzigartigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung legen. Das Preisgeld des Mercur Awards kommt Klammer und Maurer gerade recht. „Wir haben schon so viele neue Ideen, was wir aus unseren weggeschmissenen Gegenständen alles machen können”, freut sich Maurer. Konkrete Pläne zur Weiterentwicklung des Unternehmens gibt es bereits: „Die Lattenroste sind ja Endverbraucher-Müll. Jetzt haben wir uns den postindustriellen Abfall angesehen, um daraus Möbel zu machen. Erste Prototypen wurden bereits aus Rohren gefertigt. Aber wir sind generell immer auf der Suche nach Unternehmen, wo viel Müll anfällt, und die Interesse daran haben, mit einem Start-up zusammenzuarbeiten”, ergänzt Maurer.
Zero-Waste-Insektenfabrik mitten in der Stadt
Dass viel Engagement notwendig ist, um etwas Neues auf die Beine zu stellen, bestätigt Katharina Unger, Gründerin der Livin Farms AgriFood GmbH: „Es ist wirklich sehr viel Arbeit, etwas Innovatives auf den Markt zu bringen”, so die Unternehmerin. Ihr Start-up - eine Zero Waste-Insektenfabrik - nahm den ersten Platz ein. Die erste Anlage wird bereits für einen Kunden in Spanien errichtet, weitere sind in anderen europäischen Ländern in fortgeschrittenen Planungsphasen.
Reduktion von Kosten und Entwicklungszeit von Medikamenten
Für Aufsehen sorgten zwei Spinn-Offs der Wiener Universität für Bodenkultur (Boku), die in den Kategorien Gesundheit und Digitalisierung jeweils den ersten Platz davontrugen. Novasign (Kat. Gesundheit) bietet KI-gestützte SoftwareLösungen, die die Bioprozessentwicklung bei der Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen. Bis zu 70 Prozent der Versuche können so eingespart werden, was sowohl die Entwicklungszeit als auch die Kosten reduziert. Die K Technologie kann zudem bei Bedarf autonom in den Prozess eingreifen, frühzeitig Fehlerquellen erkennen und diesen entgegenwirken. Ein Ver[1]fahren mit viel Potenzial für die Zukunft, dass in der Praxis von Unternehmen der pharmazeutischen Industrie bereits genutzt wird.
Holographische Mikroskopie Methode
Ebenso ein Spin-off der Boku ist die Holloid GmbH, die den Sieg in der Kategorie Digitalisierung errang. Ihre Software-Lösung ermöglicht ein 3D-Verfahren zur Bildgebung und Messung von Bakterien, Algen, Hefen und Mikroplastik bzw. anderen Kleinstpartikeln in Echtzeit. Ein[1]gesetzt werden kann dies etwa zu Kontrollzwecken bei der Herstellung von beispielsweise Pharmazeutika oder Lebensmitteln wie auch in der Umweltüberwachung. Mit Hilfe dieser holgraphischen Online-Mikroskopie-Lösung kann überprüft werden, jeweils ob und welche Mikroorganismen oder -partikel vorhanden sind sowie in welchem Zustand sie sich befinden. Ein autonom ablaufendes Verfahren, was eine mikroskopische Überwachung in nahezu jeder Umgebung und rund um die Uhr wirtschaftlich machbar werden lässt. Die Methode kann damit klassische Analyseverfahren wie etwa optische Mikroskopie, PCR-Analysen oder mikrobiologische Anwendungen ablösen. „Wir wollen einen ganz großen Impact zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt leisten", freuen sich die Gründer Pinar Frank und Marcus Lebesmühl über das Potenzial ihrer Entwicklung.