
EU-Wirtschaftspanorama 4/2025
Ausgabe 31. Jänner
Lesedauer: 16 Minuten
Im Brennpunkt
Was steckt drin?
- Innovationslücke schließen: Von KI-Förderung bis zu besseren Bedingungen für Startups
- Dekarbonisierung und Industrialisierung: Eine wettbewerbsfähige Industrie braucht Energiesicherheit
- Wirtschaftliche Sicherheit: Europa muss seine Abhängigkeiten reduzieren
Internationaler Handel
- Modernisiertes EU-Chile-Handelsabkommen tritt in Kraft
- Fünf Jahre Brexit: Trotz „Zäsur“ bleibt Großbritannien ein wesentlicher Exportmarkt Österreichs
Kurz & Bündig
Jobs+Jobs+Jobs
EU-Wochenvorschau
Im Brennpunkt
Kompass für Wettbewerbsfähigkeit: Wie Europas Wirtschaft wieder an die Spitze soll

Die EU-Kommission hat ihr wirtschaftspolitisches Grundsatzprogramm für die kommenden fünf Jahre präsentiert. Der „Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“ orientiert sich an den Berichten der Wirtschaftsexperten Enrico Letta und Mario Draghi zu Binnenmarkt beziehungsweise Wettbewerbsfähigkeit. Das Programm ist entlang von drei Säulen gegliedert:
Erstens soll die Innovationslücke zu den USA und China geschlossen werden. Damit soll Europa wieder zum Vorreiter bei innovativen Geschäftsideen und technologischer Spitzenforschung werden. Zweitens sollen die Klimaziele des Green Deal mit der industriellen Wettbewerbsfähigkeit in Einklang gebracht werden. Dritten sollen strategische, einseitige Abhängigkeiten der EU reduziert und die wirtschaftliche Resilienz gesteigert werden. Dies soll unter anderem durch Diversifizierung der Lieferketten geschehen. Die verschiedenen Maßnahmen der drei Säulen werden in den nachfolgenden Artikeln ausführlicher beleuchtet.
Von Bürokratieabbau bis zur Fachkräfteoffensive
Neben den drei Säulen ziehen sich fünf horizontale Faktoren wie ein roter Faden durch den Kompass. Insbesondere will die EU-Kommission Verwaltungsaufwände für Unternehmen „drastisch“ reduzieren. Erreicht werden soll das unter anderem mit dem sogenannten „Omnibus-Paket“, das voraussichtlich am 26. Februar vorgestellt wird. Durch die Verschlankung von Berichtsregeln für Nachhaltigkeit sowie von Sorgfaltspflichten sollen besonders KMUs entlastet werden. Ehrgeiziges Ziel sind Reduktionen von 35 Prozent. Größere Unternehmen sollen künftig um ein Viertel weniger Berichtspflichten haben.
Außerdem sollen bestehende Hindernisse im Binnenmarkt weiter abgebaut und Normungsverfahren reformiert werden. Eine entsprechende Strategie dazu soll bis Mitte 2025 vorliegen. Die Schaffung einer „Europäischen Spar- und Investitionsunion“ soll private Investitionen in den Standort Europa begünstigen. Weiters will die EU die Qualifikation von Arbeitnehmer:innen besser mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes in Einklang bringen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Nicht zuletzt soll die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden.
Hohe Energiekosten und strategische Abhängigkeiten bremsen Europa
Gleichzeitig mit dem Competitiveness Compass hat die EU-Kommission den Jahresbericht 2025 zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Binnenmarkt veröffentlicht. Er gibt einerseits Einblicke in die aktuelle Situation europäischer Unternehmen, andererseits zeigt er die vielfältigen Herausforderungen auf, vor denen Europa auf dem Weg zurück zur internationalen wirtschaftlichen Spitzenposition steht.
Der Bericht zeigt, dass hohe Energiekosten, Überkapazitäten in Drittstaaten sowie strategische Abhängigkeiten die Wettbewerbsfähigkeit der EU belasten. Trotz eines starken Binnenmarkts mit 450 Millionen Verbraucher:innen und 23 Millionen Unternehmen behindern regulatorische Hürden weiterhin das volle Potenzial. Innovationslücken, langsame Digitalisierung und geringe Investitionen in Forschung und Entwicklung bremsen Unternehmen aus. Die EU bleibt jedoch weltweit führend im Dienstleistungsexport und zweitgrößte Warenexporteurin.
Europa braucht den Wettbewerbs-Turbo für eine zukunftsfitte Wirtschaft
Aus Sicht der heimischen Wirtschaft ist der Wettbewerbsfähigkeits-Kompass jedenfalls ein wichtiges Signal. Er zeigt jene Stellschrauben auf, an denen für eine zukunftsfitte Wirtschaft gedreht werden muss. Die stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel betont: „Europa muss den Wettbewerbs-Turbo zünden, damit wir wieder zu unseren internationalen Konkurrenten aufschließen können. Jetzt ist es entscheidend, rasch in die Umsetzung zu kommen.“
Zahlreiche Anregungen für ein wettbewerbsfähiges und zukunftsfittes Europa sowie die wichtigsten Forderungen der heimischen Wirtschaft an die EU-Kommission finden Sie auch in der Agenda 2024+ der WKÖ.
Ansprechpartner: Sebastian Köberl
Was streckt drin?
Innovationslücke schließen: Von KI-Förderung bis zu besseren Bedingungen für Startups

Die erste Säule des Wettbewerbskompasses ist die Schließung der Innovationslücke mit den USA und China. Das langfristige Ziel: Die EU soll wieder als Heimat von innovativen Geschäftsideen und Spitzentechnologien etabliert werden. Forschung, Innovation, Wissenschaft und Technologie sollen in den Mittelpunkt der europäischen Wirtschaft gestellt werden. Der Fokus liegt vor allem auf fortgeschrittenen Werkstoffen, Quanten- und Biotechnologien, Robotik und Weltraumtechnologien.
Aktuell hat Europa jedoch ein Ausgabenproblem bei Forschung und Entwicklung: Mit insgesamt 2,2 Prozent des BIP hinkt der Kontinent anderen Industrienationen wie Japan (3,3 Prozent) und den USA (3,5 Prozent) hinterher. Zusätzlich hat Europa mit einer Schieflage seines Innovationsstandortes zu kämpfen. Laut aktuellem European Innovation Scoreboard (EIS) geht innerhalb der EU die Schere zwischen den vor allem im Norden gelegenen innovationsstarken Ländern und den Mitgliedstaaten mit niedrigerer Innovationskraft weiter auf. Demnach stagniert die EU unter anderem bei der Attraktivität der Forschungssysteme und der Verfügbarkeit von Fachkräften.
Die Stärkung des Innovationsstandorts Europa soll unter anderem durch mehr und stärker fokussierte Investitionen sowie Erleichterungen für Start-Ups erfolgen, damit diese wachsen können. Dazu gehören auch einfachere Möglichkeiten, um Kapital aufzunehmen. Diese Strategie will die EU bis Mitte dieses Jahres vorlegen. Außerdem soll eine zusätzliche, optionale und EU-weite Rechtsordnung für Unternehmen geschaffen werden. Dieses „28. Regime“ soll Binnenmarkthürden beseitigen. Es soll Ende 2025 bzw. Anfang 2026 vorgestellt werden.
Im Bereich der künstlichen Intelligenz sollen sogenannte „KI-Gigafabriken“ die Entwicklung und Anwendung fördern. Die Initiative zu KI-Fabriken soll noch im ersten Quartal dieses Jahres anlaufen. Außerdem will die EU bis Mitte 2025 eine Quanten-Strategie und bis Ende des Jahres einen Quantum Act erarbeiten. Die kommenden zwei Jahre sollen überdies die Geburt eines European Biotech Acts und einer European Biotech Strategy erleben.
Ansprechpartnerin: Katja Schager
Dekarbonisierung und Industrialisierung: Eine wettbewerbsfähige Industrie braucht Energiesicherheit

Als zweite Säule soll ein gemeinsamer Plan für Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit erarbeitet werden. Die EU hält weiterhin an ihren Klimazielen fest, diese sollen jedoch in Einklang mit den Bedürfnissen der Wirtschaft gebracht werden. Damit will man die Abwanderung von energieintensiven Industriezweigen wie Stahl und Chemie verhindern. Erreicht werden soll das durch eine moderne und faire Wettbewerbspolitik.
Darüber hinaus ist ein strategischer Dialog über die Automobilindustrie unter der Leitung von Ursula von der Leyen bereits angelaufen. Als Ergebnis der Stakeholder:innen-Diskurse und einer parallellaufenden öffentlichen Konsultation soll bis 5. März ein Aktionsplan erstellt werden. Damit soll die Automobilindustrie, die rund 13 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze sichert und für etwa eine Billion Euro des EU-BIPs verantwortlich ist, gestärkt werden.
Neben mehr Investitionen in grüne Energie sollen die Energiepreise langfristig auf ein leistbares Niveau gedrückt werden. Gerade Letzteres ist für eine dekarbonisierte und wettbewerbsfähige Industrie überlebenswichtig. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Europas Energiepolitik auf den Kopf gestellt. Die Gaspreise sind durch den Umstieg auf LNG-Flüssiggas mittelfristig dreimal so hoch wie in den USA. Auch die Strompreise waren 2022 mehr als doppelt so hoch wie in den USA und China. Gleichzeitig stockt der Ausbau erneuerbarer Energie. Zwischen 2010 und 2022 ist der Erneuerbaren-Anteil in der EU nur von 14 auf 23 Prozent gewachsen (Österreich liegt bei knapp 34 Prozent).
„Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit müssen Hand in Hand gehen. Damit unsere Industrie international erfolgreich arbeiten kann, braucht sie attraktive Rahmenbedingungen in Europa“, betont die stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU einen Rechtsakt zur beschleunigten Dekarbonisierung der Industrie angekündigt. Die Einzelheiten dieses Gesamtvorhabens werden am 26. Februar im Rahmen des Clean Industrial Deal vorgelegt.
Bis Ende dieses Jahres sollen außerdem Aktionspläne für Stahl, Metall und für die chemische Industrie, ein Investitionsplan für nachhaltigen Transport, eine Europäische Hafenstrategie, ein Plan für Hochgeschwindigkeitszüge und eine Evaluierung des Carbon Border Mechanism (CBAM) präsentiert werden
Für den Beginn von 2026 hat die EU-Kommission einen weiteren Aktionsplan angekündigt. Dieser soll die Elektrifizierung, also den Umstieg von der Nutzung fossiler Energie zu Strom, vorantreiben. In Verbindung damit soll ein European Grid Package den Ausbau des europäischen Stromnetzes unterstützen.
Ansprechpartnerin: Barbara Lehmann
Wirtschaftliche Sicherheit: Europa muss seine Abhängigkeiten reduzieren
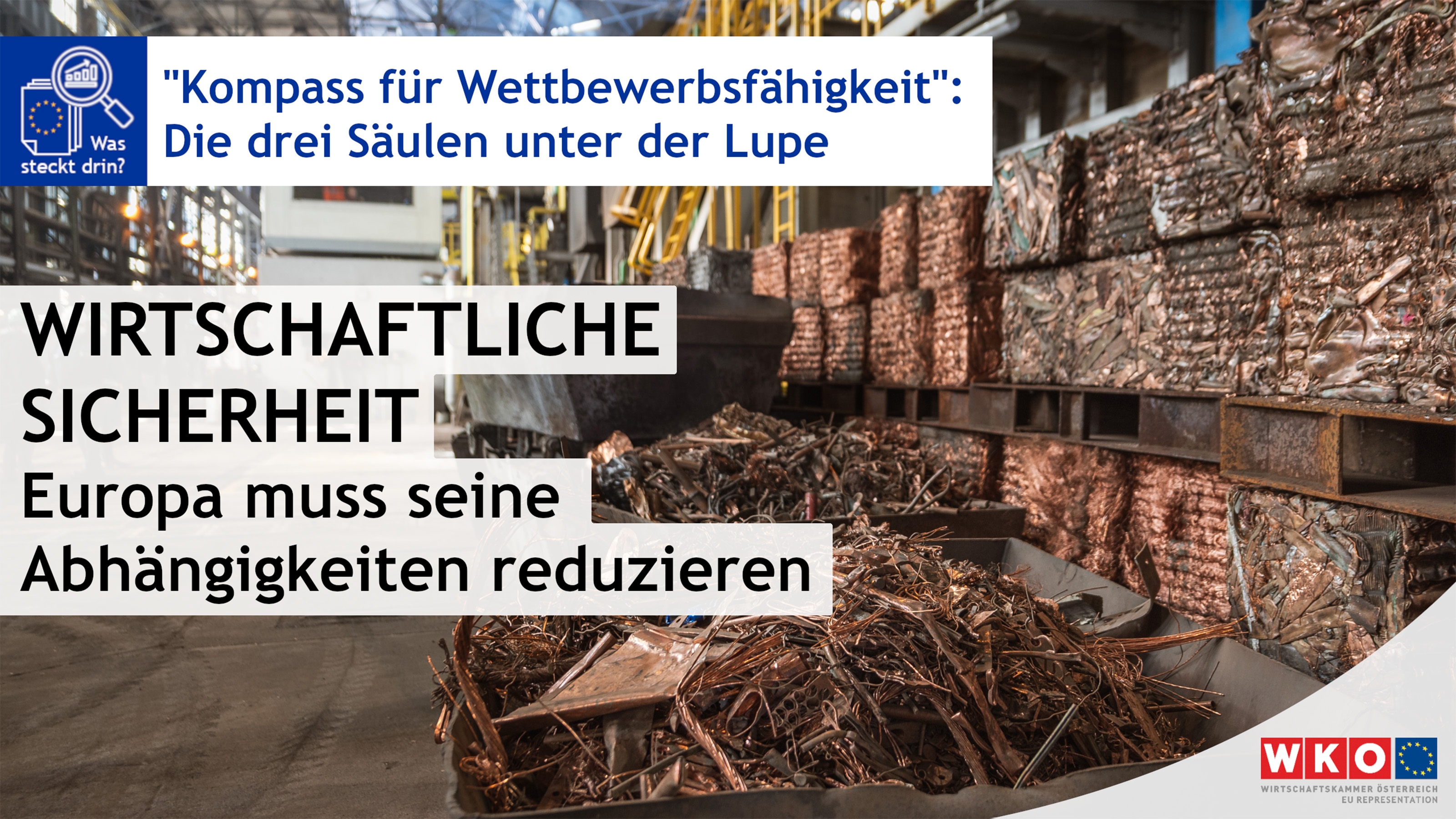
Die dritte Säule des Kompasses für Wettbewerbsfähigkeit ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Sicherheit und Verringerung von Abhängigkeiten. Insbesondere bei kritischen Rohstoffen und Gütern muss Europa mehr Resilienz schaffen. Erreicht werden soll das unter anderem durch eine gemeinsame europäische Einkaufsplattform für kritische Rohstoffe. Diese soll bis zum Herbst 2025 stehen. Weniger Zeit lässt sich die EU mit den Critical Medicines Act, der die Abhängigkeit bei wichtigen Medikamenten und Medizinprodukten verringern soll. Dieser wird bereits für den 11. März 2025 erwartet.
Ein weiterer Hebel für größere Unabhängigkeit bei Rohstoffen sind zusätzliche Investitionen in eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft. Im Bereich öffentlicher Vergaben denkt die Kommission über eine europäische Präferenz bei kritischen Sektoren und Technologien nach. Verzahnt mit wirtschaftlicher Sicherheit und Resilienz ist auch die Europäische Verteidigungsfähigkeit. Ein White Paper dazu wird für den 19. März erwartet. Eine Woche später sollen eine Strategie für innere Sicherheit sowie eine EU-Bereitschaftsstrategie veröffentlicht werden.
Vor allem muss Europa sein internationales Handelsnetz ausbauen. Besonders im Nahen Osten und Südamerika sind die USA und China aktiver als die EU. Noch dazu sind europäische Staaten übermäßig von protektionistischen Handelsmaßnahmen betroffen. Ein Beispiel für den zunehmend protektionistischen Trend im internationalen Handel sind die von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten Einfuhrzölle für Waren und Dienstleistungen aus der EU. Bei entsprechenden Gegenmaßnahmen der EU ist bereits bei 10-prozentigen Zöllen in den kommenden vier Jahren ein Rückgang des EU-BIP von insgesamt 2,9 Prozent laut IW Köln zu erwarten. Das würde für Europa einen Wohlstandsverlust von 420 Milliarden Euro bedeuten.
Diversifizierte Lieferketten, neue und ambitionierte Handelsabkommen sowie ein breites Netz aus Handelspartnern sind für Europa wichtiger denn je. Positive Schritte der EU in diese Richtung sind unter anderem das modernisierte Abkommen mit Mexiko und die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Malaysia. Das Handelsabkommen mit Chile, das am 1. Februar 2025 in Kraft tritt, ist unter anderem ein Schritt zur Diversifizierung der Quellen kritischer Rohstoffe. Chile besitzt die größten Kupfer- und Lithiumreserven der Welt und ist damit für Europa ein bedeutender Partner für die grüne Transformation.
Ansprechpartner: Sebastian Köberl
Internationaler Handel
Modernisiertes EU-Chile-Handelsabkommen tritt in Kraft

Chile ist der drittgrößte Handelspartner der EU in Lateinamerika. Für Chile wiederum stellt die EU den zweitgrößten Warenexportmarkt dar. Mit 1. Februar 2025 tritt das Interims-Handelsabkommen zwischen beiden Partner.innen in Kraft. Dieses soll die bilateralen Handelsbeziehungen weiter vertiefen und das bestehende Assoziierungsabkommen modernisieren. Bereits das 2002 zwischen der EU und Chile getroffene Assoziierungsabkommens hat den Warenhandel zwischen beiden Märkten um mehr als160 Prozent erhöht.
Im Rahmen des Interims-Handelsabkommens sollen unter anderem umfassende Zollsenkungen für EU-Ausfuhren und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für EU-Waren auf dem chilenischen Markt erfolgen. Gleiche Bedingungen sollen ebenso für Investor:innen auf beiden Märkten geschaffen werden. EU-Unternehmen sollen erleichterten Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Chile erhalten.
„In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist die Diversifizierung der Absatz- und Beschaffungsmärkte ein Gebot der Stunde. Mit dem jüngst erfolgten Abschluss der Modernisierung des EU-Mexiko Global Agreement und dem Neustart der Verhandlungen über ein Abkommen mit Malaysia setzt die EU ein klares Zeichen gegen Abschottung und Protektionismus. Ein wichtiges Signal für Offenheit und internationalen Handel ist zudem die Einigung auf das Mercosur-Partnerschaftsabkommen“, betont Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der WKÖ.
Für Österreichs Wirtschaft ist Chile nach Brasilien der zweitwichtigste Handelspartner in Südamerika. Größter Exportschlager sind Maschinenbauerzeugnisse, die rund die Hälfte der rot-weiß-roten Ausfuhren ausmachen. Zudem kann das modernisierte Abkommen mit Blick auf die Rohstoffversorgungssicherheit verstanden werden. Chile besitzt die größten Kupfer- und Lithiumreserven der Welt und ist damit für Europa ein bedeutender Partner für die grüne Transformation.
Ansprechpartner: Sebastian Köberl
Fünf Jahre Brexit: Trotz „Zäsur“ bleibt Großbritannien ein wesentlicher Exportmarkt Österreichs

Mit 31. Jänner 2025 jährt sich der Austritt Großbritanniens aus der EU zum fünften Mal. Politisch und wirtschaftlich gesehen war es für beide Seiten eine Zäsur. Größte Herausforderung ist dabei der Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt.
Trotz Handels- und Kooperationsabkommen haben sich unter anderem bürokratische Aufwände auf beiden Seiten erhöht, was besonders für KMU eine große Belastung darstellt. Durch das Ende der Personenfreizügigkeit hat Großbritannien mit einem massiven Mangel an qualifizierten Fachkräften zu kämpfen. Besonders betroffen sind Branchen wie Bau, Logistik und Gastronomie, die traditionell stark auf EU-Arbeitskräfte angewiesen waren.
Neue Zollverfahren, Grenzkontrollen und administrative Prozesse haben die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes im Vereinigten Königreich beeinträchtigt. Der britische Rechnungshof beispielsweise schätzt, dass allein die neuen Grenzkontrollen den Staat bisher über 5 Milliarden Pfund gekostet haben. Laut einer Studie der Beratungsfirma Cambridge Econometrics Anfang 2024 hat der Brexit die britische Wirtschaftsleistung um etwa 0,4 Prozent pro Jahr geschmälert. „Im Rückblick überwiegen klar die Nachteile für beide Seiten, die der Austritt aus dem EU-Binnenmarkt für die Bürger:innen und die wirtschaftliche Entwicklung gebracht hat“, wie Mariana Kühnel, betont Mariana Kühnel, stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin.
Auch die EU-Warenexporte nach Großbritannien haben sich weniger dynamisch entwickelt als in andere Weltmärkte. Im Jahr 2023 sind sie nur um 4,7 Prozent gestiegen. Laut einer aktuellen Studie liegen die britischen Warenexporte in die EU für die Jahre 2021 bis 2023 um 27 % (und die Importe aus der EU um 32 %) niedriger als wenn das Land noch EU-Mitglied wäre. Trotzdem bleibt Großbritannien als zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa ein wesentlicher Handelspartner der EU und besonders für Österreich. Mit einem Exportvolumen von 5,5 Milliarden Euro war das Vereinigte Königreich 2023 der zehntwichtigste Exportmarkt für österreichische Waren. Der heimische Export erzielte 2023 hier einen Warenbilanzüberschuss von 2,6 Milliarden Euro.
Die österreichischen Warenexporte haben sich mit einem Plus von 21,3 Prozent im Jahr 2023 auch stärker als der EU-Durchschnitt entwickelt. Diese Entwicklung wurde zuletzt jedoch gebremst, denn die österreichischen Ausfuhren nach Großbritannien ging in den ersten zehn Monaten 2024 um 8,1 Prozent zurück.
Mit der richtigen Vorbereitung und professionellen Beratung bleibt Großbritannien weiter ein attraktiver Markt für heimische Unternehmen, wie der österreichische Wirtschaftsdelegierte in London, Michael Müller, zusammenfasst. Das AußenwirtschaftsCenter London und der Brexit-Infopoint beraten jährlich rund 1.000 österreichische Unternehmen. Heimische Unternehmen haben bereits mehr als 8 Mrd. Euro in Großbritannien investiert und haben dort rund 300 Niederlassungen.
Ansprechpartner: Sebastian Köberl
Kurz & Bündig
EZB senkt Leitzins erneut
Der Rat der Europäischen Zentralbank hat am 30. Jänner erneut beschlossen, alle drei Leitzinssätze um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Der Hauprefinanzierungszinssatz, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der EZB besorgen können, wird von 3,15 Prozent auf 2,9 Prozent gesenkt. Der Einlagenzins, den Banken für angelegte Gelder erhalten, wird von 3,0 auf 2,75 Prozent gesenkt. Der Spitzenrefinanzierungssatz sinkt von 3,4 auf 3,15 Prozent. Die Euro-Währungshüter:innen begründen ihre Entscheidung mit einem anhaltenden Abwärtstrend bei der Inflationsrate in der Eurozone. Es wird erwartet, dass die Inflation im Laufe dieses Jahres auf den mittelfristigen Zielwert von 2 Prozent sinkt. Es ist bereits die fünfte Senkung, seit die EZB im vergangenen Juni die Zinswende eingeleitet hat. Im Gegensatz dazu hat die US-Notenbank FED in ihrer ersten Sitzung nach Donald Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus am Mittwoch, 29.1.2025, beschlossen, ihre Zinsen weiterhin auf hohem Niveau in der Spanne von 4,25 - 4,5 Prozent zu belassen. Trotz der kürzlich wieder gestiegenen Inflationsrate in den USA, übte der US-Präsident Kritik. Die Forderung nach niedrigeren Zinssätzen war Teil seines Wahlkampfes.
Strategischer Dialog zur Automobilindustrie gestartet
Die EU-Kommission hat am 30. Jänner den strategischen Dialog zur Zukunft der europäischen Automobilindustrie gestartet. Präsidentin Ursula von der Leyen brachte führende Branchenvertreter:innen, Sozialpartner:innen und Expert:innen zusammen, um zentrale Herausforderungen zu diskutieren. Ziel ist ein umfassender Aktionsplan, der am 5. März vorgestellt werden soll. Dieser soll Innovationen fördern, die Wettbewerbsfähigkeit sichern und die Branche nachhaltig gestalten. Vier thematische Arbeitsgruppen erarbeiten Lösungen zu Klimaschutz, Industriepolitik, Digitalisierung und Fachkräftesicherung. Eine öffentliche Konsultation dazu läuft parallel. Der Dialog soll Europas Automobilsektor, der für rund 13 Millionen direkte und indirekte Jobs sowie etwa eine Billion Euro des EU-BIPs verantwortlich ist, für den globalen Wettbewerb stärken.
Jobs+Jobs+Jobs
EUROPOL sucht Specialist
Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) mit Sitz in Den Haag (Niederlande)
- Specialist – Synthetic Drugs, Drugs B Team, EU Drugs Unit
Temporary Agent, Grade: AD 6, Reference: Europol/2025/TA/AD6/670, Deadline for applications: 03/02/2025, 23:59 CET
Weitere Informationen sind online abrufbar.
FRONTEX sucht Project Manager
Die Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX) mit Sitz in Warschau (Polen)
- Project Manager and Services Delivery Senior Officer
Temporary Agent, Grade: AD 8, Reference: RCT-2024-00081, Deadline for applications: 11/02/2025, 12:00 (Warsaw time)
Weitere Informationen sind online abrufbar.
EUROPOL sucht Specialist
Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) mit Sitz in Den Haag (Niederlande)
- Specialist – Database Administrator, ICT Operations Unit
Temporary Agent, Grade: AD 6, Reference: Europol/2025/TA/AD6/657, Deadline for applications: 12/02/2025, 23:59 CET
Weitere Informationen sind online abrufbar.
EU-Wochenvorschau
Sitzungen der Europäischen Kommission
5. Februar
- Mitteilung über die Bewältigung von Herausforderungen bei Plattformen für den elektronischen Handel
Ausgewählte Tagungen des Rates
3. Februar
- Informelles Treffen der EU-Führungsspitzen
- Europäische Verteidigung
- Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten
- Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten
- Finanzierung: Mobilisierung privater Finanzmittel, bestmögliche Nutzung von EU-Instrumenten und dem EU-Haushalt sowie zusätzliche gemeinsame Möglichkeiten, die in Betracht gezogen werden könnten
- Stärkung und Vertiefung von Partnerschaften
- Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten
- Europäische Verteidigung
3.–4. Februar
- Informelle Ministertagung „Wettbewerbsfähigkeit“ (Binnenmarkt und Industrie) in Warschau
- Bei der gemeinsamen informellen Tagung der für Wettbewerbsfähigkeit und Handel zuständigen Minister:innen geht es um die Gewährleistung einer kohärenten Handels- und Industriepolitik zur Stärkung der globalen Position der EU. Die Minister:innen werden die derzeitigen Instrumente zur Unterstützung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU und des europäischen industriellen Ökosystems bewerten. Außerdem werden sie erörtern, wie Handels- und Industriepolitik besser miteinander verknüpft, die Widerstandsfähigkeit des Binnenmarktes erhöht und ein gemeinsames Konzept für die externen Partner der EU entwickelt werden kann.
- Informelle Tagung der Außenminister in Warschau
Ausschüsse des Europäischen Parlaments
3. Februar
- Haushaltsausschuss (BUDG) & Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON)
- Aussprache mit Elena Flores, Vorsitzende des Lenkungsausschusses des Programms InvestEU
- Aussprache mit Elena Flores, Vorsitzende des Lenkungsausschusses des Programms InvestEU
6. Februar
- Unterausschuss für Steuerfragen (FISC)
- Öffentliche Anhörung zum Thema „Ein kohärenter steuerlicher Rahmen für den Finanzsektor der EU“
- Aussprache mit Laura Kövesi, Europäische Generalstaatsanwältin, und Yannic Hulot, Vorsitzender von Eurofisc, über „Die Rolle der EUStA und von Eurofisc bei der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs in der EU“
- Aussprache mit Kommissionsmitglied Wopke Hoekstra über Schlüsselprioritäten im Bereich Steuern
Ausgewählte Fälle des Europäischen Gerichtshofes
Donnerstag, 6. Februar 2025
Schlussanträge des Generalanwalts am Gerichtshof in der Rechtssache C-492/23 Russmedia Digital und Inform Media Press
Haftung von Hosting-Anbietern
Das Opfer einer Anzeige mit verunglimpfendem und beleidigendem Inhalt, die ein Unbekannter auf der Website www.publi24.ro veröffentlicht hatte, verlangt von der Betreiberin der Website, Russmedia Digital, immateriellen Schadensersatz. Der Anzeige zufolge bot die Betroffene sexuelle Dienstleistungen an. Die Anzeige enthielt Fotos und die Telefonnummer der Betroffenen und wurde rasch von anderen Websites aufgegriffen. Russmedia macht geltend, ihre Rolle sei rein technischer Natur, sie stelle die Website lediglich zur Verfügung. Vor dem mit dem Rechtsstreit befassten rumänischen Gericht stellt sich die Frage, ob Russmedia als Hosting-Anbieter und datenschutzrechtlich Verantwortlicher für diese Anzeige mit offensichtlich rechtswidrigem Inhalt haftbar gemacht werden kann.
Das rumänische Gericht hat den Gerichtshof hierzu um Auslegung der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr sowie der Datenschutz-Grundverordnung ersucht.
Generalanwalt Szpunar legt am 6. Februar seine Schlussanträge vor.
Schlussanträge der Generalanwältin am Gerichtshof in den verbundenen Rechtsmittelsachen C‑71/23 P Frankreich / CWS Powder Coatings u. a. und C‑82/23 P Kommission / CWS Powder Coatings u. a.
Titandioxid
Titandioxid ist ein anorganischer chemischer Stoff, der insbesondere in Form eines Weißpigments wegen seiner färbenden und deckenden Eigenschaften in diversen Produkten (von Farben über Arzneimittel bis hin zu Spielzeug) verwendet wird.
Auf die Initiative Frankreichs hin und nach Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung der Europäischen Chemikalienagentur nahm die Kommission mit Verordnung 2020/2172 die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von Titandioxid vor und stellte feste, dass es sich dabei um einen Stoff handele, bei dem der Verdacht bestehe, dass er beim Menschen karzinogene Wirkung habe, wenn er in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser von höchstens 10 μm eingeatmet werde.
Die Unternehmen CWS Powder Coatings, Brillux, Daw, Billions Europe u.a. haben diese Verordnung vor dem Gericht der EU mit Erfolg angefochten. Das Gericht erklärte die Verordnung für nichtig. Frankreich und die Kommission haben gegen dieses Urteil des Gerichts Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt.
Generalanwältin Ćapeta legt am 6. Februar ihre Schlussanträge vor.
Weitere Informationen C-71/23 P
Weitere Informationen C-82/23 P
Ausgewählte laufende Konsultationen
Energie
- Ökodesign – elektronische Displays (Überprüfung der Anforderungen)
13.11.2024–5.2.2025
Energie
- Energieverbrauchskennzeichnung – elektronische Displays (Überprüfung der Anforderungen)
13.11.2024–5.2.2025
Binnenmarkt
- Sicherheit von Aufzügen – Bewertung der Aufzugrichtlinie
7.11.2024–3.2.2025
Wettbewerb
- Staatliche Beihilfen im Luftverkehr – Leitlinien der Kommission für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften (Überarbeitung)
11.12.2024–5.3.2025
Energie
- EU-Vorschriften über Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika – gezielte Bewertung
12.12.2024–21.3.2025
Binnenmarkt
- Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge – Evaluierung
13.12.2024–7.3.2025
Lebensmittelsicherheit
Maritime Angelegenheiten und Fischerei
- Gemeinsame Fischereipolitik - Bewertung
27.1.2025–21.4.2025
REDAKTION:
Alexander Maurer, EU Representation der WKÖ
Wenn Sie das EU-Wirtschaftspanorama regelmäßig zugeschickt bekommen wollen oder sich vom Verteiler streichen lassen möchten, mailen Sie uns.
MEDIENINHABER:
Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz/Copyright/Haftung